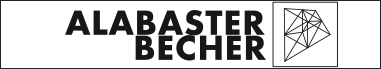M E I N A R B E I T E N, I C H U N D W I R
|
ꟷ Ich verstehe meine Arbeit als künstlerische Forschung. Das Schaffen von Kunst ist nicht-sprachliches Denken. Mit dem künstlerischen Arbeiten kann auf Hirnareale zugegriffen werden in denen die Information nicht verbalisierbar abgespeichert ist. ꟷ Im Prozess der Beschäftigung mit einer Fragestellung, gebe ich diesen nicht mit Sprache zu fassenden Fragmenten eine Form und transferiere sie in den Raum außerhalb meines Inneren. Sodass sie kommunizierbar werden um Position und Disposition auch für Andere sein zu können.
ꟷ Als Dorfkind einer erzgebirgischen Arbeiter_innenfamilie war der Comic mein einziger Zugang zur Kunst. ꟷ In der Schule mochte ich nur die Geometrie, da mir diese schon damals hoch ästhetisch erschien. ꟷ Drei Tage nach meinem Beschluss, all meine Leinwände auf einem Haufen zu verbrennen, wurde ich zu meiner ersten Soloausstellung eingeladen. Seither bin ich dabei. ꟷ Viele Jahre geschah die Kunst kleinformatig neben meinem Beruf in der Suchthilfe. Heute braucht das Denken und das Tun mehr Platz. ꟷ Neben meinem besuchbaren Atelier bin ich ständig vertreten durch Tina Warmuth und das - Studio for Appliet and Contemporary Art. ꟷ Aktuell arbeiten wir an einem Ausstellungskonzept für neue Arbeiten.
|